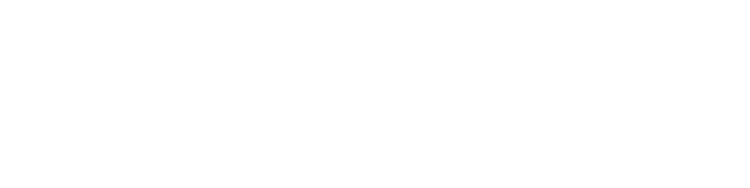Geborgen, wo Nähe zählt
In der palliativen Pflege benötigen die Patientinnen und Patienten viel emotionale Zuwendung.
Wenn Heilung nicht mehr möglich ist, zählt jede Geste der Zuwendung. Die Palliativpflege im Caritas Baby Hospital begleitet schwerkranke Kinder und ihre Familien unter schwierigen Bedingungen und mit viel Engagement.
Es ist eine Szene, die sich tief einprägt. Ein schwerkrankes Kind wird nach zwei Wochen stationärer Behandlung aus dem Caritas Baby Hospital entlassen. Nicht, weil es genesen ist, sondern weil es keine Hoffnung mehr auf Genesung gibt. Die Eltern nehmen ihr Kind mit nach Hause – verzweifelt und erschöpft.
Solche Fälle treten auf. Wenn Kinder unheilbar krank sind, können Familien schnell an ihre Grenzen stossen. Das zeigt, wie notwendig kindgerechte Palliativpflege ist. Gleichzeitig offenbaren sich auch die Herausforderungen – für die Familien wie für das Caritas Baby Hospital. Denn auch dort befindet sich die Palliativversorgung erst in den Anfängen.
Ein kleiner Anfang mit grosser Bedeutung
Die Möglichkeiten sind derzeit begrenzt: Es fehlt an spezialisierten Pflegefachpersonen, an stabilen Versorgungsstrukturen, an Platz und finanziellen Mitteln. Kulturelle Hürden – etwa das mangelnde Bewusstsein oder die Zurückhaltung vieler Familien beim Thema Lebensende – erschweren die Versorgung zusätzlich.
Und doch sind erste Schritte gemacht: Vier Einzelzimmer für schwerkranke Kinder bieten Raum für Ruhe und Abschied in Würde. Sozialarbeiterinnen stehen Familien mit Trauerbegleitung und psychosozialer Unterstützung zur Seite. Trotz einge-schränkter Ressourcen gelingt es dem Caritas Baby Hospital, grundlegende Elemente kindgerechter Palliativpflege bereitzustellen.
Ein Beispiel ist die so genannte FLACC-Skala – ein bewährtes Instrument zur Schmerzerfassung bei kleinen Kindern. Gerade Säuglinge zeigen Schmerzen oft nur durch Mimik oder Bewegung. Die Skala hilft, diese Zeichen systematisch zu deuten, um Schmerzen frühzeitig zu erkennen und gezielt mit Medikamenten oder beruhigender Zuwendung zu lindern.
Ein weiterer Baustein ist das Ethikkomitee des Kinderspitals. Er wird hinzugezogen, wenn medizinische Entscheidungen schwerwiegende Fragen aufwerfen – etwa bei sehr begrenzter Lebenserwartung. Das Gremium vereint Fachpersonen aus Medizin, Pflege, Sozialarbeit und Seelsorge. Gemeinsam mit den Familien beraten sie, was im besten Interesse des Kindes ist. Dabei zählen nicht nur Fachwissen, sondern auch Empathie und respektvoller Dialog.

Gerade bei der Behandlung schwer erkrankter Kinder ist eine enge Abstimmung besonders wichtig.
Gemeinsam lernen, gemeinsam wachsen
Eine wissenschaftliche Studie des Caritas Baby Hospital mit der Cardiff University/Wales aus dem Jahr 2025 zeigt, wohin der Weg führen muss: Es braucht verbindliche Leitlinien, gezielte Schulungen und fokussierte Zusammenarbeit. Vor allem aber braucht es Zeit und Geduld. Denn in einem stark ausgelasteten Gesundheitssystem sind solche Angebote nur gemeinsam zu meistern.
«Wir stehen am Anfang», sagt Suhair Qumsieh, Pflegedienstleiterin am Kinderspital. «Aber wir wissen, wie wichtig es ist, Kindern mit schweren Krankheiten nicht nur medizinisch, sondern menschlich zu begegnen – bis zuletzt.»
Fotos: © Meinrad Schade